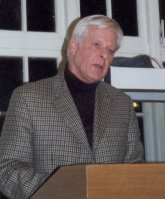Es war für Lüneburg und das Johanneum nicht gerade eine glanzvolle Zeit, die J.A.P. Schulz 1757 – 1764 als Schüler des Johanneums erlebte. Der seit dem 17. Jahrhundert andauernde wirtschaftliche Abstieg Lüneburgs, das als Provinzstadt kaum mehr Entwicklungsmöglichkeiten bot, wurde verschärft durch die Folgen des Siebenjährigen Krieges (1756 – 63). Für Lüneburg bedeutete das die Einquartierung von Verwundeten in alle leerstehenden Gebäude inklusive des Johanneums, das 1763 nur 49 Schüler in drei Klassen besaß. 1758 hatte eine Fleckfieberepidemie Lüneburg heimgesucht, der 7% der etwa 9000 Einwohner zum Opfer gefallen waren.Hinzu kam der grundlegende Wandel der Gesellschaft und des Musiklebens. Das Zeitalter des Rokoko löste die Barockzeit ab und das Bürgertum wurde gegenüber dem Adel und der Kirche wirtschaftlich und kulturell bedeutsamer.
Rationalismus und Aufklärung führten zu einem Niedergang der Kirchenmusik, die bis dahin immer noch die Hauptquelle der Musik gebildet hatte, wie man am Werk J.S. Bachs sehen kann. In der Lüneburger Michaeliskirche entfernte man Ende des 18. Jahrhunderts ganz im Sinne des Rationalismus die religiösen Kunstschätze, vereinfachte die Gottesdienstliturgie und vermied lang dauernde Orgelpräludien.
Dennoch war es gerade die Kirchenmusik, die den Schüler J.A.P. Schulz, der am 31.3. 1747 als Sohn eines Bäckermeisters getauft wurde, begeisterte und musikalisch förderte. Obwohl sein Vater ihn gern als Prediger in Lüneburg gesehen hätte, erkannte seine Mutter die musikalische Begabung ihres Sohnes und schickte ihn zunächst auf die Michaelisschule, wo er im Schulchor wegen seiner schönen Stimme auch als Solist bei Kirchenmusiken mitwirkte und beim Kantor von St. Michaelis Instrumentalunterricht erhielt. Als Schulz die Michaelisschule verließ und zum Johanneum wechselte, sang er auch hier im Schulchor und erhielt beim Kantor der Johanniskirche und Telemannschüler J. Ch. Schmügel gründlichen Unterricht in Musiktheorie und Komposition. In der Biographie von Reichardt (Kassel 1947) heißt es: „Er kam nun auf die Johannisschule, wo er drei Jahre blieb und außer den gewöhnlichen Wissenschaften und Sprachunterricht auch im Singen Unterricht erhielt. Bald war er der erste Diskantist im Chor, der bei Kirchenmusiken und während des Winterhalbjahres auch auf der Straße zu singen pflegte. Er nahm daneben Unterricht bei dem damals geschätzten Organisten an der Johanniskirche Schmügel, außerdem noch Unterricht am Klavier. Schmügel sprach oft mit großer Verehrung von Kirnberger in Berlin und weckte dadurch sein Verlangen nach dieser damals blühenden Residenz der Tonkunst.“
Sein Vater wollte verhindern, dass er Musiker wurde, und sagte des öfteren: ‚ Lass nur das ewige Fiedeln und nimm … ein geistliches Buch vor die Nase ! Ich will keinen Bierfiedeler an dir erleben.‘ Seit seinem 14. Lebensjahr stand Schulz in Briefkontakt zu C. Ph. E. Bach (1714- 85), der damals in Berlin wirkte, und entwickelte deshalb den Wunsch dort zu studieren. 1765 verließ Schulz seine Heimatstadt und erhielt Unterricht bei J. Ph. Kirnberger, der ein Schüler J. S. Bachs gewesen war. 1768 konnte er auf Empfehlung Kirnbergers als Klavierlehrer an die polnische Gräfin Sapieha vermittelt werden, die er auf Bildungsreisen durch Europa begleitete. Als er ab 1773 wieder in Berlin weilte, begann seine eigentliche Karriere. Er verfasste Artikel für ein Musiklexikon, gab unter dem Namen Kirnbergers die „Wahren Grundsätze zum Gebrauch der Harmonie“ heraus ( 1773, Nachdruck Hildesheim 1970 ) und wurde 1776 Musikdirektor des Französischen Theaters in Berlin, für das er die Oper L‘ impromptu schrieb. Als das Theater aus Kostengründen vom königlichen Hof aufgelöst wurde, nahm er eine Stelle als Kapellmeister bei Prinz Heinrich, dem Bruder Friedrichs II., am Schloß von Rheinsberg an, wo er u.a. Schauspielmusiken wie Athalia und das Melodram Le Barbier de Séville (1786) komponierte. Nachdem man am Hof von Rheinsberg seinen kompositorischen Stil, der sich nicht mehr am strengen Kontrapunkt orientierte, kritisierte, gab er seine Stelle auf. Er wurde 1787 Hofkapellmeister am dänischen Königshof in Kopenhagen und verwirklichte in seiner praktischen Arbeit auch seine musiktheoretischen Interessen. Schon während der Zeit in Rheinsberg hatte sein Hauptaugenmerk immer mehr den volkstümlichen Liedern gegolten, durch die er sich gemäß den Idealen der Aufklärung eine kulturelle und sittliche Förderung des Volkes erhoffte. 1782 und 1785 veröffentlichte er zwei Bände seiner Lieder im Volkston und wurde dadurch zum Haupt der sogenannten „Zweiten Berliner Liederschule“, die sich um möglichst volksnahe Liedkompositionen bemühte. Er schuf nach dem erstarrten Odenstil der Barockzeit ein neues schlichtes Kunstlied. 1790 erschien der dritte Band dieser Sammlung. Die Noten der bekannten Lieder Der Mond ist aufgegangen und Ihr Kinderlein kommet stammen aus der Feder von J. A. P. Schulz. Mit seiner Schrift Gedanken über den Einfluss der Musik auf die Bildung eines Volkes… (1790) machte er sich als Musiktheoretiker einen Namen. Er gab er als Ziele für eine volkstümliche Musik an: die Besserung des moralischen Charakters, die Veredelung der Empfindung und die Verbreitung von Freude und Geselligkeit im Volk. Er hatte keine Probleme damit, als Deutscher mit Singspielen über die Bauernbefreiung das dänische Nationalempfinden und die Verbundenheit der verschiedenen dänischen Landesteile zu fördern, was ihm hohe Anerkennung seitens der Dänen einbrachte. Im Familienleben durchlebte J.A.P. Schulz Glück und Unglück. 1781 heiratete er die 16- jährige Wilhelmine Flügel, die aber schon 3 Jahre später an Tuberkulose starb. Zwei ihrer Kinder starben bald nach der Geburt. Schulz heiratete 1786 Caroline Flügel, die Schwester seiner ersten Frau, die ebenfalls der Tuberkulose 1797 erlag. 1792 verlor er einen Sohn durch einen häuslichen Unfall. Schulz wurde 1795 wegen seiner angegriffen Gesundheit aus dem dänischen Dienst entlassen; auch er hatte sich vermutlich bei seiner Frau mit Tuberkulose angesteckt. Er starb am 10.6. 1800 in Schwedt. Aus Anlass seines 200- jährigen Todestages fand im Juni 2000 ein Vortrag von Dr. Andreas Jaschinski und ein Konzert mit einigen seiner Werke im Lüneburger Rathaus statt.
Autor: Gerhard Glombik
Festveranstaltung zur Einweihung der Büste von Johann Abraham Peter Schulz
in der Ratsbücherei Lüneburg am 8.11. 2002 , 18.00 Uhr
Dr. Muthard Hackbarth, der Vorsitzende des Freundeskreises der Ratsbücherei, eröffnete die Veranstaltung, indem er die Initiative des früheren Leiters der Ratsbibliothek, Herrn Gerhard Hopf würdigte, eine Büste zum Andenken an J.A.P. Schulz vor der Ratsbibliothek aufzustellen. (Die Ratsbücherei sammelt Werke von J. A. P. Schulz und in der nahen Waagestraße lag das Haus seiner Familie). Herr Dr. Hackbarth dankte Herrn Rolf Müller, dem neuen Leiter der Ratsbibliothek, für die Weiterführung des Planes von Herrn Hopf, den Sponsoren für die finanzielle Ermöglichung der Herstellung der Büste und der Bildhauerin Frau Barbara Westphal für die gelungene künstlerische Arbeit.
Frau Bürgermeisterin Birte Schellmann lobte das selbstständige kulturelle Engagement von Lüneburger Bürgern, das geradezu als Vorbild auch für die Politiker der Stadt dienen könne. J. A. P. Schulz sei nun nach langer Abwesenheit endgültig wieder nach Lüneburg heimgekehrt. Das Werk von J. A. P. Schulz sollte stärker als Anregung für die musikalische Bildung in den Schulen genutzt werden.
Der Beitrag des Johanneums zur Einweihungsfeier bestand darin, den geladenen Gästen das Leben von J.A.P. Schulz in drei Abschnitten vorzustellen. Herr Gerhard Glombik gab eine kurze Einführung und stellte die Mitwirkenden des Johanneums vor.
Schülerinnen der Klasse 11 lasen aus den drei autobiographischen Skizzen, die Schulz hinterlassen hatte.
Ein Chor von 11 Schülerinnen unter der Leitung von Frau Waltraut Elle- Ellbrechtz (nicht auf dem Foto) und unter Begleitung von Herrn Karl Mielke (nicht auf dem Foto) sang das bekannteste Schulz- Lied Der Mond ist aufgegangen zunächst in der Chorversion, danach als Kanon in der Bearbeitung von Christiane Frey. Das Foto zeigt einige Schülerinnen des Chors vor ihrem Auftritt. Eine Schülerin spielte als Solistin am Piano aus den six pièces das Andante sostenuto und am Schluss die zwei Tänze Für mein Minchen, die Schulz kurz vor seinem Tod für seine damals 6 Jahre alte Tochter geschrieben hatte.
Herr Gerhard Hopf, der frühere Leiter der Ratsbücherei, hielt die Laudatio. Er beschrieb die Stellung von J.A.P. Schulz im Schatten der großen Komponisten des 18. Jahrhunderts mit den Worten: „Unbekannt heißt nicht unbedeutend“. Schulz habe musiktheoretisch auf hohem Niveau gearbeitet, die Spitze der einflussreichen 2. Berliner Liederschule gebildet und einen wichtigen Beitrag zur Lösung der deutschen Oper vom französischen Stil geleistet. Er sei darüber hinaus von seinen Zeitgenossen als eine sympathische Persönlichkeit wahrgenommen worden, der man sofort bei der ersten Begegnung habe vertrauen können.